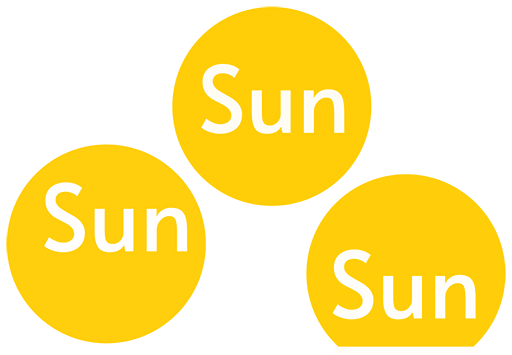Thermische Sanierung und Ertüchtigung der Haustechnik gehören zusammen
Abstract:
Eine Thewosan-Sanierung erfordert unbedingt die Adaptierung der gesamten Haustechnik an die neuen Gegebenheiten. Sonst nutzt man nicht nur die möglichen Energieeinsparungen viel zu wenig aus, auch das Wohnklima in einem überheizten Haus ist nicht besonders angenehm. Vor allem kann es aber zu einer fehlerhaften Heizkostenabrechnung kommen, bei der Bewohner die Heizung der Nachbarn mitbezahlen müssen!
Die Haustechnik ist Teil der thermischen Sanierung!
Ein neues Gesamtkonzept für die Haustechnik nach der thermischen Sanierung eröffnet Chancen für Umstellungen, kreative Erweiterungen und Verbesserungen des Wohnkomforts und sichert die gerechte Aufteilung der Heizkosten für alle Bewohner.
Dazu braucht es innovative Partnerfirmen bei der Haustechnik, eine engagierte Hausverwaltung und Eigentümer, denen die technische Ertüchtigung ihres Hauses und damit die langfristige Werterhaltung wichtig ist.
Die thermische Sanierung
Thermische Sanierung ist eine wichtige Voraussetzung, wenn ein Mehrfamilienhaus auf erneuerbare Energie umgestellt werden soll. In den letzten Jahrzehnten wurden in Wien zahlreiche Häuser Thewosan saniert.
Vor der thermischen Sanierung werden zunächst alle baulichen Eckdaten über das Haus ermittelt, die verwendeten Baustoffe, Fenster, Dachkonstruktion und alle relevanten Bauteile kategorisiert und ein Energieausweis des Bestandes als Ausgangswert erstellt. Dann fügt man die möglichen Dämm- und Verbesserungsmaßnahmen hinzu und errechnet einen Energieausweis mit den neuen Werten. Je nach Höhe der Energieersparnis richtet sich auch die Fhöhe der örderung. Schafft man es, das Haus thermisch so weit zu verbessern, dass es einem Niedrigenergiehaus entspricht, gibt es eine deutlich höhere Förderung, als wenn man nur die Werte für einen Neubau erzielt. Für den mit der Aufgabe befassten Architekten oder Baumeister ist es oft eine ziemliche Tüftelarbeit, bis ein Heizwert erzielt wird, dass man eine höhere Förderungsstufe beantragen kann. Oft wird dieser Wert nur knapp erreicht.
In der Vergangenheit war mit der Durchführung der thermischen Sanierung das Verfahren abgeschlossen, und es wurde angenommen, dass die errechneten Energieeinsparungen auch eintreten würden.
Anpassung der Heizung nach der thermischen Sanierung
In der Praxis ist das natürlich nicht der Fall und schon gar nicht, wenn man an der Heizanlage des Hauses keine Anpassungen vornimmt! Im Heiz- und Kältekostenabrechnungsgesetz ist zwar vage davon die Rede, dass nach einer thermischen Sanierung die Heizung neu eingestellt werden muss, aber was genau gemacht werden muss, ist nicht näher präzisiert:
Eine Thewosan-Sanierung kann das Klima des Hauses ganz schön durcheinander bringen. Die Gebäudehülle verhindert durch die Dämmschicht, dass im Winter die Heizungswärme durch die Wände verloren geht, die neuen Fenster geben viel weniger Wärme nach außen ab und Kälte kann nicht mehr so leicht in das Haus eindringt. Ändert man nichts an der Heizung, wird es im Haus deutlich wärmer.
Viele Häuser in Wien haben eine Zentralheizung und von denen sind wiederum viele an die Fernwärme angeschlossen. Reduziert man die Vorlauftemperatur nicht, steigt die Temperatur in den Heizkreisen des Hauses an und Wärme wird auch über die Rohre an die Räume in den Wohnungen abgegeben. Die Wohnungen werden nicht mehr hauptsächlich mit den dafür vorgesehenen Heizkörpern mit Wärme versorgt, sondern die Heizungsrohre dienen als „Zusatzheizung“.
Einrohrheizung
Bis weit in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden aus Kostengründen in den Neubauten Einrohrzentralheizungen eingebaut. Bei Einrohrsystemen spart man gegenüber Zweirohrheizungen eine Menge teurer Rohrleitungen ein. Dass dies für die gesamte Lebenszeit höhere Heizkosten für die Bewohner bedeutet, wurde von den Errichtern in Kauf genommen. Die Energiepreise waren niedrig, und Wohnraum musste in großer Zahl günstig erstellt werden.
Neben einer ganzen anderen Reihe von ungünstigen Effekten ist bei einer Einrohrheizung das Problem der Abwärme besonders auffällig, besonders, wenn zusätzlich auch die Dämmung der Heizungsrohre eingespart wurde! Wenn die Rohre dann noch in der Wand oder im Estrich verbaut wurden, ist eine nachträgliche Sanierung praktisch unmöglich.
Die Heizkörper sind bei einem Einrohrsystem hintereinander in einem Heizkreis verbaut. Das zirkulierende Wasser kühlt also sukzessive ab, wenn Radiatoreb Wärme entnehmen und an die Wohnräume abgeben. In größeren Mehrfamilienhäusern können Heizkreise mehrere Wohnungen in einem Stockwerk umfassen. Die erste Wohnung im Kreis hat noch sehr heißes Wasser, in der letzten Wohnung ist es schon erheblich abgekühlt. Die dadurch geringere Wärmeabgabe kann man bis zu einem gewissen Grad durch die Größe der Heizkörper ausgleichen. Auch im letzten Raum des Heizkreises sollten es die Bewohner ausreichend warm haben. Das erfordert wiederum eine hohe Vorlauftemperatur, was, wie gesagt, eine hohe Abwärme am Anfang des Heizkreises zur Folge hat.
Das oft übersehene „dunkle Geheimnis“ der Heizung
Wenn es in der Wohnung zu warm ist, lüftet man vielleicht öfter und dreht dann die Heizkörper zurück oder gleich ab. Möglicherweise können Bewohner am Anfang eines Heizkreises ihre Radiatoren in der ganzen Wohnung reduzieren und haben dennoch ausreichend Wärme, um einen kalten Winter zu überstehen.
Die Messgeräte können an den abgedrehten Heizkörpern keinen Verbrauch registrieren. Im Frühjahr findet der Ableser nur sehr wenige oder gar keine „Stricherln“, die er in sein Protokoll eintragen kann. Der Bewohner freut sich natürlich auf eine niedrige Heizkostenabrechnung und wundert sich nur, dass sein Verdunster-Messgerät überhaupt etwas anzeigt, obwohl die Heizung den ganzen Winter abgedreht war. „Das ist die Verdunstung! Dann bis zum nächsten Jahr.“ sagt der Ableser und geht.
Was dabei völlig übersehen wird, ist die Tatsache, dass die im Haus verbrauchte Energie für die Heizung zumindest zum überwiegenden Teil über den in den Messgeräten registrierten Verbrauch verrechnet wird. Wer „Stricherln“ auf seinem Zähler hat, zahlt für den Nachbarn mit, der keine hat. Das kann oft jahrelang übersehen werden und muss weder der Hausverwaltung, der Heizungsfirma noch der Ablesungsfirma auffallen, die die Heizkostenabrechnung erstellt und schon gar nicht den Bewohnern.
Anzeichen für eine fehlerhafte Heizkostenabrechnungen
Die Anzeichen, dass etwas nicht mehr stimmt mit der Heizung nach der Thewosan-Sanierung: Der Energieverbrauch und Heizkosten sind nicht so stark zurückgegangen, wie im Energieausweis vorausberechnet, in einer Reihe von Wohnungen ist es zu warm, die Bewohner beschweren sich, einige Bewohner zahlen unterdurchschnittlich wenig für die Heizung, andere deutlich mehr.
Je verbrauchsabhängiger die Aufteilung der Heizkosten ist, desto unfairer ist sie in diesem Fall. Die ursprüngliche Idee, sparsames Heizen zu belohnen, wird hier praktisch „pervertiert“. Ein möglicher Aufteilungsschlüssel von 80:20 belastet die Hausparteien, deren Messgeräte einen Verbrauch anzeigen, maximal, Bewohner ohne Verbrauchsanteile tragen nur 20% der Kosten des Umlageverfahrens. Ein Schlüssel von 70:30 ist in Wien üblich.
Lösungen
Als „Soforthilfe“ für die nächste Heizkostenabrechnung muss man daher mindestens den Aufteilungsschlüssel auf 50:50 zurücksetzen oder den Verbrauch nach Quadratmetern durchführen, was der Gesetzgeber allerdings nicht vorsieht, wenn es Verbrauchsmessgeräte gibt. Es gibt noch andere Verfahren, bei denen zusätzlich Verbrauchseinheiten für die Rohrabwärme
eingerechnet werden, aber auch da werden Bewohner bevorzugt, die ihre Wohnungen am Beginn eines Heizkreises haben.
Zur Beseitigung des Problems ist es dringend notwendig, so schnell wie möglich eine echte „Reparatur“ des Systems vorzunehmen!
Hydraulischer Abgleich
Zunächst sollte man einen hydraulischen Abgleich durchführen, bei dem der Wärmebedarf für jeden Raum des Hauses neu berechnet wird. Dann kann man Ventile im Heizkreis oder bei den Radiatoren tauschen und Wärmezähler einbauen, um die Temperatur der Flüssigkeit in den Heizkreisen besser kontrollieren und steuern zu können. Vor allem kann man dann die Vorlauftemperatur so weit absenken, dass die Wärmeabgabe über die Heizrohre deutlich reduziert wird, und alle Bewohner müssen wieder ihre Heizkörper aufdrehen, um ihre Wohnungen ausreichend warm zu bekommen. Einen hydraulischen Abgleich zu machen, ist eine komplexe Rechenaufgabe, die viel Zeit erfordert, und es ist schwierig, den hohen Aufwand, der dafür notwendig ist, dem Kunden klarzumachen und entsprechend bezahlt zu bekommen. Der hydraulische Abgleich war bis vor kurzem anscheinend eine der unpopulärsten Arbeiten in der Heizungsbranche.
Seit Mai 2023 gibt es eine staatliche Förderung für den hydraulischen Abgleich, und zwar die Hälfte der Planungskosten bis zu einer Höhe von € 15.000 und weitere € 7.500 für Adaptierungsmaßnahmen, wie den Einbau von Ventilen oder Wärmezählern. Interessant dabei ist die Höhe der Förderung und dass schon die Planung gefördert wird.
Auch im Entwurf zur Sanierungs- und Dekarbonisierungsverordnung, die 2024 in Kraft treten soll, ist eine Förderung des hydaraulischen Abgleichs vorgesehen und anscheinend kann man beide Förderungen miteinander kombinieren.
Für den eventuell notwendigen Austausch von Heizkörpern, um auch bei abgesenkter Vorlauftemperatur die letzten Räume in einem Heizkreis angenehm temperieren zu können, gibt es allerdings keine Zuschüsse.
Reduktion der Vorlauftemperatur
Die wichtigste Maßnahme zur Reduzierung der Rohrwärmeverluste ist die Absenkung der Vorlauftemperatur. Nur wenn die Temperatur der Rohre nicht mehr ausreicht, um die Wohnung zu heizen, werden die Bewohner ihre dafür vorgesehenen Heizkörper wieder aufdrehen und so eine gerechte Berechnung der Heizkosten ermöglichen. Außerdem spart die Reduktion der Vorlauftemperatur auch Heizenergie und zwar für jedes Grad weniger 1,6% weniger Energie.
Gründe für die übersehenen Fehlabrechnungen der Heizkosten
Es ist kaum nachvollziehbar, warum die Auswirkungen auf die Heizkostenabrechnung nach einer thermischen Sanierung von so vielen Beteiligten übersehen wurden. Vielleicht liegt es daran, dass wesentliche Kontrollmechanismen im Verfahren fehlen. Die zentralen Kennzahlen für die Höhe einer Thewosan-Förderung basieren auf Rechenmodellen, bei denen der Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand verglichen wird, um die Höhe der Förderung zu bestimmen. Ob der Ist-Wert überhaupt stimmt, wird nicht mit dem tatsächlichen Energieverbrauch verglichen, obwohl es einfach wäre, ein 3-Jahres-Mittel vor Baubeginn zu erheben. Auch nach Abschluss ist, so weit ich weiß, kein Nachweis über den Erfolg der Sanierung erforderlich. Hausverwaltungen müssen nicht nach 3 Jahren bekanntgeben, wie hoch die tatsächliche Einsparung war. Gerade wenn der errechnete Wert knapp die Marke für eine erheblich höhere Förderung erreicht hat, wäre es, wenn man die Dekarbonisierung Ernst nimmte, interessant zu wissen, ob dieses Ziel erreicht wurde.
Vermutlich lassen sich für Bestandshäuser kaum exakte Werte im Voraus berechnen, und es kann leicht sein, dass verschiedene Gegebenheiten die Einhaltung der Vorgaben verhindern. Das Verfahren erweckt jedoch den Eindruck von rechnerischer Exaktheit, die in der Realität kaum gegeben ist. Das bedeutet nicht unbedingt, dass bei Nichterreichen des selbstgesteckten Ziels die Förderungen teilweise zurückgezahlt werden müssen. Es könnte jedoch den Blick dafür schärfen, warum dieses Ziel nicht erreicht wurde und was noch getan werden könnte, um es zu erreichen. Die Eigentümer tragen den Löwenanteil einer Thewosan-Sanierung, und oft gibt es einen genauen Zeitplan, wann sich die hohen Investitionen durch den niedrigeren Energieverbrauch amortisiert haben sollten. Wenn der tatsächliche Verbrauch erheblich über dem prognostizierten liegt, verzögert sich natürlich auch dieser Break-even-point um Jahre.
Weitere Perspektiven
Während die Abwärme innerhalb der Gebäudehülle für die Beheizung der Wohnungen genutzt wird, gibt es wahrscheinlich bei einer Zentralheizung im Bestand noch andere „Lecks“, durch die Wärme und damit Energie ungenutzt entweichen. Schlecht gedämmte Heizungsrohre in den Kellerräumen oder eine unzureichende Dämmung der Anlage selbst führen zu hohen Verlusten, die heute nicht mehr akzeptabel sind. Auch die zentrale Warmwassererzeugung sollte bei der Erstellung des neuen Energiekonzepts nach einer thermischen Sanierung genau untersucht werden. Wahrscheinlich sind auch hier die Leitungsrohre ohne Dämmung verlegt worden und kaum zugänglich und es gibt ebenfalls hohe Verluste durch Abwärme. Auch wenn dies sich nicht ungerecht auf die Warmwasserkosten auswirkt, da alle gleichermaßen beteiligt werden, ist es dennoch eine Energieverschwendung, die die Bewohner teuer bezahlen müssen.
Es sollte überlegt werden, ob das heiße Wasser nicht mit Solarstrom am eigenen Dach und mit Hilfe einer Wärmepumpe erzeugt werden kann, insbesondere wenn die unvermeidbare Restabwärme im Keller dafür genutzt werden kann. Ein zumindest 20 Grad warmer Keller sollte es der Wärmepumpe ganzjährig ermöglichen, die notwendige Temperatur für das Warmwasser günstig zu erzeugen.
Wenn man sich für eine Solaranlage und eine Wärmepumpe entscheidet, sollte gleichzeitig überlegt werden, ob nicht auch die Kühlung des Hauses möglich ist. Besteht Bedarf? Wo im Haus wird es im Sommer zu warm? Kann das bestehende System so angepasst werden, dass auch die Kühlung von Wohnungen, Stockwerken oder des gesamten Hauses möglich und wirtschaftlich ist? Muss ein Einrohrsystem umgebaut oder welche Heizkörper müssen getauscht werden? Braucht es zusätzliche Wärmepumpen auf dem Dach oder dem Dachboden, die im Sommer die Kühlung übernehmen können? Produziert die Solaranlage im Sommer genügend Strom, um die Kühlung zu ermöglichen?
Lüftungskonzept
Das Lüftungsverhalten beeinflußt ebenfalls den Heizenergieverbrauch und auch hier kann man optimierend eingreifen.
Durch die thermische Sanierung eines Mehrfamilienhauses ändert sich der Luftaustausch zwischen Innen und Außen. Das Haus ist viel “dichter” als vorher und es gibt kaum noch Bauteile oder Fugen und Ritzen, über die ein Austausch von Luft stattfinden kann. Das Raumklima in den Wohnungen ändert sich und man muss mehr lüften. Dadurch geht Wärme verloren und um die Räume wieder aufzuheizen, braucht man Energie. Ein Lüftungssystem, das die Wärme zurückgewinnt, spart nicht nur diese zusätzlichen Heizkosten, man verbessert auch das Raumklima und verhindert Schimmelbildung. Natürlich kann man weiterhin die Fenster öffnen, um mal richtig durchzulüften, aber durch den ständigen Luftaustausch ohne Wärmeverlust hat man auch so immer angenehm frische Luft in den Räumen.
Es gibt zentrale und dezentrale Lüftungssysteme. Für Häuser im Bestand eignen sich in der Regel dezentrale Geräte, die weniger Platz brauchen, besser. Man man macht einen Wanddurchstich, ein Rohr wird eingesetzt und aussen mit einer Abdeckung versehen, oft mit einer Jalousie, die die Öffnung automatisch schließt, wenn kein Luftaustausch stattfindet. Innen wird ein Lüfter mit einem Wärmetauscher montiert, der der ausströmenden Luft Wärme entzieht und damit die einströmende Luft erwärmt. Dadurch bleibt die Wärme erhalten und man spart Energie. Pollen und andere Schwebstoffe und sogar Gerüche werden mit Hilfe eines Filters, den man zweimal im Jahr reinigen sollte, entfernt. Das Lüftungsgerät wird mit Strom betrieben und braucht einen Stromanschluss, bei der Umwälzung der Luft ist bei guten Geräten kein Geräusch wahrnehmbar.
Bei einer umfassenden Sanierung macht es Sinn, für das ganze Haus ein Lüftungskonzept zu erstellen, die notwendigen Maßnahmen in den Wohnungen zu planen und die Auswirkungen auf den Heizbedarf zu berechnen. Für die Umsetzung gibt es Förderungen, die man beantragen kann, wenn man den Nutzen durch die Energieersparnis und die anfallenden Kosten berechnet hat.
Persönliche Erkenntnisse
Für einen Eigentümer, der wenig über die technische Ausstattung seines Hauses weiß, ist es schwierig, die notwendigen Informationen zu sammeln. Gerade dieser Bereich ist in Bestandshäusern schlecht dokumentiert, und es gibt kaum Unterlagen, die eingesehen werden können. Wer weiß schon, ob in seinem Haus eine Ein- oder Zweirohrheizung verbaut wurde, was das bedeutet und welche Auswirkungen das haben kann? In den Hausverwaltungen ist das Wissen um technische Details oft eher begrenzt, und welches Haus hat schon einen Energieberater, der auf mögliche Schwachstellen hinweist? Auch die Firma, die die Ablesung durchführt, die Daten sammelt und daraus die Kosten berechnet und aufteilt, „macht nur ihren Job“. Plausibilitätsrechnungen sind aus der Mode gekommen, keiner hat mehr den Überblick über das Gesamtsystem.
Die Haustechnik ist immer komplexer geworden, man kann immer genauer messen und einstellen, trotzdem ist es möglich, dass große „blinde Flecken“ entstehen, die zu völlig falschen Ergebnissen führen können, und das über Jahre. In Zeiten von „time is money“ ist es kaum mehr möglich miteinander zu reden, und jede Firma muss anscheinend schauen, dass jeder Handgriff und jede Minute Beschäftigung mit der Haustechnik eines Kunden verrechenbar ist, damit das Betriebsergebnis stimmt. Als Eigentümer kann man daher nicht davon ausgehen, dass „dienstbare Geister“ wissen, was zu tun ist, und von sich aus Vorschläge machen, wenn etwas in die falsche Richtung geht.
Abschließende Bemerkung
Es ist mir nicht darum zu tun, „Schuldige“ zu suchen oder öffentlich zu machen! In Wien gibt es viele Thewosan-sanierte Häuser, und viele davon werden eine zentrale Heizungs- und Warmwasseranlage haben. Es könnte sich also um keinen Einzelfall handeln, und zahlreiche Häuser in Wien könnten von ähnlichen Problemen betroffen sein. Dass die thermische Sanierung im Zusammenhang mit der Haustechnik betrachtet und entsprechend verbessert werden muss, wurde aufgrund fehlender Vorschriften und Kontrollen oft übersehen. Die Auswirkungen von Rohrwärmeverlusten auf verfälschte Heizkostenabrechnungen wurden lange Zeit nicht erkannt und sind auch heute nicht allgemein bekannt.
Der Artikel basiert auf eigenen Erlebnissen und Erfahrungen!